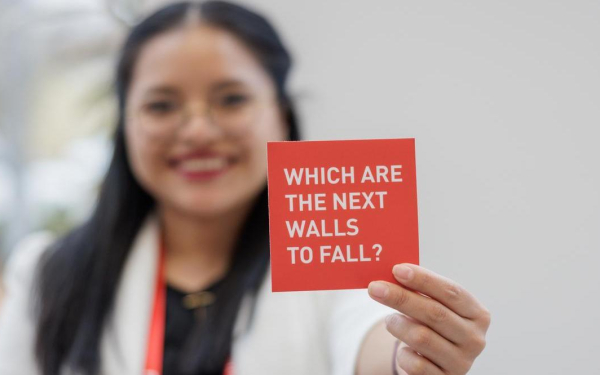Akademische Freiheit unter Druck: Wie Europas Wissenschaft sich gegen Angriffe wappnen muss

Falling Walls Foundation
Anna-Sara Lind (li.) und Eva-Inés Obergfell während der Diskussion zu "Academia under Attack".
Beim Falling Walls Science Summit 2025 diskutierten führende Wissenschaftsvertreter:innen über Bedrohungen für die akademische Freiheit – und darüber, wie Forschungseinrichtungen ihre Resilienz stärken können.
Dass es sich bei Angriffen auf die Wissenschaft nicht mehr um "übertriebene Alarmismen" handelt, wurde bei unserem Plenary Table "Academia under attack – Action againt Antidemocratic Threats" schnell deutlich. Patrick Cramer, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, verwies auf die Lage in den USA: Budgetkürzungen, politischer Druck und Einschüchterungen gefährdeten dort massiv die akademische Autonomie. Europa solle sich davor nicht sicher wähnen, betonte er, und warnte ausdrücklich vor wachsenden nationalistischen Kräften in mehreren europäischen Staaten.
Gleichzeitig wurde in der Diskussion, die Jens Martin Gurr, Kurator der VolkswagenStiftung und Professur an der Universität Duisburg-Essen, moderierte, der enge Zusammenhang von akademischer Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben – ein Fundament, das zunehmend erodiert, wenn politische Entscheidungsträger:innen Wissenschaft delegitimieren oder internationale Kooperationen einschränken.
Finanzierung, Allianzen und frühes Handeln
Den Blick auf strukturelle Fragen richtete insbesondere Harvard-Professor Daniel Ziblatt, der gleichzeitig auch Direktor der Abteilung Transformationen der Demokratie am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist. Er plädierte für ein pluraleres Fördersystem, das parallele öffentliche und private Finanzierungsquellen nutzt. Nur so könne verhindert werden, dass eine politische Mehrheit ein gesamtes Wissenschaftssystem mit einem einzigen Haushaltshebel unter Druck setze.
Ziblatt hob zudem die Bedeutung "sozialer Allianzen" hervor: Universitäten sollten enger mit Medien, Schulen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenarbeiten, um Rückhalt zu gewinnen, bevor Angriffe stattfinden. "Man darf nicht warten, bis der Angriff beginnt", sagte er. "Dann findet man sich schnell allein."
Auch Anna-Sara Lind, Leiterin der schwedischen Nationalen Untersuchung zu akademischer Freiheit und Professorin an der Uppsala Universitet, betonte, wie zentral interne und externe Aufklärung sei: Forschende müssten ihre Rechte und Pflichten im Rahmen akademischer Freiheit kennen, politische Entscheidungsträger:innen besser verstehen, was Universitäten leisten.

Daniel Ziblatt
Wissenschaftliche Kultur als Schutzwall
Ein weiteres zentrales Thema sprach Eva-Inés Obergfell, Rektorin der Universität Leipzig, an: Ohne eine robuste Wissenschaftskultur nützten selbst starke rechtliche Rahmenbedingungen wenig. Sie forderte verpflichtende Module zu demokratischer Bildung, Medienkompetenz und kritischem Denken für Studierende und Mitarbeitende. Nur so ließen sich intolerante oder anti-demokratische Dynamiken im universitären Alltag frühzeitig erkennen und abwehren.
Obergfell warnte außerdem davor, Hochschulen primär über Effizienzkriterien oder "Impact"-Metriken zu definieren. Dadurch werde die Rolle der Universität als Ort intellektueller und gesellschaftlicher Bildung geschwächt – und damit auch ihre Fähigkeit, demokratische Werte zu schützen. Fachlich wurde hervorgehoben, dass offene Debattenkultur, Pluralität und wissenschaftliche Redlichkeit zentrale Voraussetzungen sind, damit Wissenschaft widerstandsfähig bleiben kann.
Freiräume statt Papierberge
Die Notwendigkeit, Bürokratie abzubauen, unterstrichen mehrere Panelist:innen, allen voran Patrick Cramer und Maria Leptin, Präsidentin des Europäischen Forschungsrats (ERC). Cramer forderte ein Umdenken hin zu einem "System des Vertrauens" und kritisierte, dass unnötige Regulierungen Forschung verlangsamen und demokratische Systeme insgesamt als handlungsunfähig erscheinen lassen.
Leptin hob hervor, dass der wachsende Verwaltungsaufwand Forscher:innen die für kreative und risikoreiche Forschung notwendige Zeit nehme. Wettbewerbliche Verfahren seien akzeptiert, aber die Vielzahl an Anträgen, Reports und Evaluationsrunden ersticke wissenschaftliche Freiheit. Freiheit bedeute "keine endlosen Bedingungen, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben", sagte sie.

Maria Leptin (li.)
Selbstkritik und Angriffsflächen
Auf die Frage, ob akademische Diskurse selbst ungewollt Munition für populistische Erzählungen bieten, reagierten vor allem Obergfell und Lind. Obergfell warnte, dass Relativismus oder falsch verstandene Neutralität leicht missbraucht werden könnten – etwa wenn Universitäten sich scheuten, klar gegen Desinformation oder menschenfeindliche Positionen Stellung zu beziehen. Lind wies darauf hin, dass Wissenschaft strukturell "altmodisch" wirke – sie brauche Zeit, Differenzierung und Debatte. Zugleich sei gerade das heute wichtiger denn je. Sie betonte die Verantwortung der Wissenschaft, Forschungsergebnisse verständlich einzuordnen und im Dialog zu bleiben, statt nach der Publikation abzutauchen.
Maria Leptin ergänzte, dass auch interne Debatten – etwa über Reproduzierbarkeit – politisch verzerrt werden könnten. Die Diskussion sei notwendig, aber müsse wissenschaftlich sauber geführt werden.
Was jetzt zu tun ist
Am Ende der Diskussion formierten sich klare Positionen. Patrick Cramer forderte, Europa müsse "aufwachen" und seine globale Verantwortung in der Wissenschaft aktiv wahrnehmen. Maria Leptin sagte: "Beim Schutz der wissenschaftlichen Freiheit müssen wir aktivistisch sein." Daniel Ziblatt erinnerte an die Notwendigkeit kollektiven Handelns: "Man muss zusammenstehen, sonst wird man einzeln angegriffen."

Das Publikum konnte einer interessanten Diskussion lauschen.
Eva-Inés Obergfell betonte, wie wichtig es sei, Wissenschaftsmethoden transparent zu machen und politische Entscheidungsträger als Partner zu gewinnen. Und Anna-Sara Lind ergänzte, dass mehr Forschung und mehr Perspektiven nötig sind, die aufzeigen, wie die akademische Freiheit widerstandsfähiger werden kann.
Der Schutz der akademischen Freiheit, so das gemeinsame Fazit, ist kein Selbstläufer – und keine Aufgabe, die die Wissenschaft allein bewältigen kann. Er ist ein Projekt der gesamten Gesellschaft.
Künstliche Intelligenz hat Recherche und Texterstellung unterstützt.
Der Videomitschnitt aller Plenary Tables ist bei Youtube verfügbar. (Academia under Attack ab 04:09:00 min)