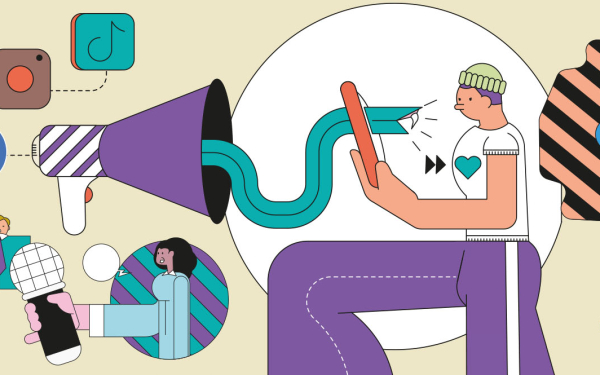ehrenwerk.tv für VolkswagenStiftung
Verkauf statt Vererbung? Wie Unternehmerfamilien sich neu erfinden
#Grundlagenforschung #Freigeist-FellowshipWas passiert, wenn Familien ihr Unternehmen nicht mehr an die nächste Generation übergeben, sondern verkaufen oder in Start-ups investieren? Die Soziologin Isabell Stamm stellt Familien in den Mittelpunkt ihrer Forschung und erhält so neue Erkenntnisse über die Weitergabe und den Erhalt von Vermögen in Deutschland.
In den meisten Familien beeinflussen die Berufsentscheidungen der Geschwister einander kaum. In Unternehmerfamilien hingegen ist das anders. Hier existiert häufig die implizite Erwartung, dass mindestens eines der Kinder einmal die Verantwortung für das Unternehmen übernimmt. Weicht ein Familienmitglied von diesem unausgesprochenen Plan ab, steigt der Druck auf die verbleibenden Geschwister. Prof. Dr. Isabell Stamm, Professorin für Organisations-, Arbeits- und Wirtschaftssoziologie an der Technischen Universität Berlin, hat diese Dynamik in ihrer Forschung immer wieder beobachtet.
Der Verkauf galt als Scheitern. Als Verrat am Lebenswerk der Eltern.
"Das stille Deuten und Interpretieren beginnt schon in der Kindheit", sagt sie. Welche Interessen zeigen die Kinder? Was verraten Studienwahl oder Berufspläne über ihre Absichten? Sogar die Partnerwahl wird nicht selten im Lichte einer möglichen Unternehmensnachfolge gedeutet. Lange Zeit verlaufen diese Prozesse unter der Oberfläche – bis es einen Moment der Zuspitzung gibt. Dann wird die Nachfolgefrage offen verhandelt, oft rituell inszeniert.
Stamm berichtet von einer Familie, in der der Sohn bei seinem Eintritt ins Unternehmen einen Siegelring überreicht bekam – ein symbolträchtiger Akt, der die Übergabe offiziell machte. "Solche Übergaben prägen das kollektive Familiengedächtnis", erzählt Stamm. "Auch bei den Geschwistern, die nie übernommen haben – oder gar nicht übernehmen wollten."
Seit vielen Jahren erforscht die Soziologin das Innenleben von Unternehmerfamilien – nicht das Unternehmen steht dabei im Fokus, sondern die Familie selbst. Denn was bedeutet es, wenn wirtschaftliches Eigentum über Generationen hinweg in familiären Strukturen weitergegeben wird? Und was passiert, wenn diese Struktur zerbricht? Diese Fragen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Forschungslaufbahn von Isabell Stamm – von der Promotion an der FU Berlin über ihre Arbeit als Gruppenleiterin an der TU Berlin und dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung bis zur Professur. Seit wenigen Monaten baut sie nun an der TU Berlin den Lehrstuhl für Organisation, Arbeits- und Wirtschaftssoziologie auf und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Ungleichheit und Vermögensverteilung in Deutschland.

ehrenwerk.tv für VolkswagenStiftung
Isabell Stamm im Videoportrait: Start-up oder Siegelring? Vermögenselite im Wandel
Eine stille Revolution: Verkauf als neue Norm
Als Isabell Stamm 2007 und 2008 für ihre Doktorarbeit an der Freien Universität Berlin erste Interviews führte, war der Verkauf eines Familienunternehmens noch ein Tabu . "Der Verkauf galt als Scheitern. Als Verrat am Lebenswerk der Eltern." Doch im Laufe ihrer Forschung bemerkte sie eine stille, aber tiefgreifende Veränderung: Immer mehr Familien entschieden sich bewusst gegen die innerfamiliäre Nachfolge – und für den Verkauf.
Mit der Förderung durch das Freigeist-Programm der VolkswagenStiftung konnte Stamm diesen Wandel an der TU Berlin systematisch untersuchen. Im Projekt Entrepreneurial Group Dynamics richtete sie den Fokus auf kollektives familiäres Unternehmertum – also Ehepaare, Geschwister, Eltern und Kindern, die gemeinsam ein Unternehmen führen. Denn, Unternehmertum ist ein komplexes soziales Geflecht, in dem Männer wie Frauen zentrale Rollen einnehmen – als Mitgründer:innen, Unterstützer:innen oder Nachfolger:innen.
Dabei zeigte sich: Seit Ende der 1980er Jahre rückt das Thema außerfamiliäre Nachfolge mehr in den Fokus. Heute ist der Verkauf nicht nur akzeptiert, sondern der Regelfall. Stamm erklärt diesen Wandel durch mehrere Faktoren: demografische Veränderungen, veränderte Werte in der jüngeren Generation, aber auch politische Narrative.
Eine Reihe von politischen Initiativen auf Bundes- und Landesebene nahm sich dem Nachfolgethema an. Es gab die Angst, dass wenn sich niemand aus der Familie das Unternehmen übernehmen möchte und niemand anderes gesucht wird, nicht nur Produktivität, sondern auch Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, erläutert Stamm. Es entstanden staatlich geförderte Plattformen, Nachfolgelotsen und Matching-Portale für Unternehmensverkäufe.
Doch was nach außen wie eine Erfolgsgeschichte aussieht, ist oft ein sozial anstrengender Prozess. Bis der Verkauf abgewickelt ist, bleibt er in vielen Familien ein streng gehütetes Geheimnis – in einigen Fällen wird selbst die Familie nicht eingeweiht, Mitarbeitende erst recht nicht. "Die Sorge ist, dass Verkaufspläne zu Verunsicherung und Spekulation führen und das setzt die Familie unter enormen Druck", erzählt Stamm.

Isabell Stamm mit ihrem Kollegen Allan Sandham im Lichthof der TU Berlin.
Die Eigentumseliten
Nach dem Ende der Freigeist-Förderung setzte Stamm ihre Forschung am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln fort. Hier leitete sie die Forschungsgruppe "Unternehmen, Eigentum und Familienvermögen" und arbeitete im Bereich "Vermögen und soziale Ungleichheit" mit acht bis zehn Wissenschaftler:innen zusammen. "Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht sich in einem so großen Team gemeinsam mit den Themen zu beschäftigen und Schwerpunkte zu setzen. Das war sehr besonders", erzählt sie voller Begeisterung.
Die Familie ist nicht mehr an ein Familienunternehmen gebunden, sondern an ein Familienvermögen.
In über 70 Interviews mit Mitgliedern hochvermögender Familien lernte sie deren spezifische Organisationsform kennen. "Diese superreichen Familien sind keine Unternehmerfamilien im klassischen Sinne mehr. Die Familie ist nicht mehr an ein Familienunternehmen gebunden, sondern an ein Familienvermögen." Die Mitglieder der Familie haben meistens Anteile an einer Vermögensverwaltungsgesellschaft oder an einer Familienstiftung. "Die Familienmitglieder sind als Anteilhaber, als Gesellschafter miteinander verbunden – oft auch weit über die Kernfamilie hinaus", analysiert Stamm.
In superreichen Familien, die ihr Vermögen über viele Unternehmen und Beteiligungen hinweg organisieren, spielt der Verkauf eines Unternehmens eine andere Rolle als in klassischen Unternehmerfamilien. Während dort oft das zentrale Familienunternehmen betroffen ist – mit persönlicher Bindung und emotionaler Bedeutung –, handelt es sich bei den Superreichen häufig nur um eine von vielen Investitionen ohne direkte Verbindung.
Solche Familien treffen sich nicht mehr zum Betriebsjubiläum, sondern zu Gesellschafterversammlungen mit integriertem Familienwochenende. "Da wird gemeinsam Fußball gespielt oder Ski gefahren – aber auch über Werte, Investitionen und die Rolle der Familie als Eigentümerin reflektiert", erzählt Stamm mit einem Lächeln auf den Lippen. Hier geht es weniger um die Frage der Nachfolge von einem Unternehmen, sondern darum, wie Angeheiratete ins Familiengeflecht integriert werden können, wie man mit dem eigenen Vermögen umgeht und welche Werte man nach außen vertritt .
Start-ups: Die neue Bühne der Eigentumseliten
Immer häufiger fließt das Kapital der Superreichen nicht ins traditionelle Familienunternehmen sondern in Start-ups. Menschen hochvermögender Familien treten zunehmend als Investor:innen in Erscheinung. In ihrem neuen Projekt The Capital’s Shadow: Wealth Concentration in Startup Ecosystems , das seit 2025 erneut durch eine Förderung der VolkswagenStiftung unterstützt wird , geht Isabell Stamm gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Julia de Groote der Frage nach, was passiert, wenn Reichtum auf innovationsgetriebene Start-up-Ökosysteme trifft.
Start-ups verbinden den Glanz des Unternehmertums mit der Möglichkeit, durch kluge Investitionen Vermögen zu vermehren – und sie bieten eine Bühne. Viele junge Erb:innen suchen eine eigene Geschichte innerhalb der großen Familienerzählung. Und die beginnt heute eben nicht mehr zwangsläufig im elterlichen Betrieb, sondern bei der Investition in eine innovative Neugründung. "Sie suchen nach einer Aufgabe, sie wollen sich unternehmerisch beweisen, gerade weil es in der eigenen Familie schon mal eine Person gab, die den großen unternehmerischen Sprung geschafft hat", erzählt Stamm mit Faszination in der Stimme.
Es besteht die Gefahr, dass nur die Ideen bestimmter Gründer:innen gefördert werden – und andere außen vor bleiben.
Wenn in der Start-up-Szene Erfolg von dem Vermögen unterschiedlicher Akteure abhängt, könnte das problematische Folgen haben. "Es besteht die Gefahr, dass nur die Ideen bestimmter Gründer:innen gefördert werden – und andere außen vor bleiben", warnt Stamm. "In einem Feld, das mit öffentlicher Förderung und großer gesellschaftlicher Erwartung aufgeladen ist, müssen wir uns fragen: Wer investiert eigentlich in wen – und warum?" Denn wer entscheidet, welche Ideen gefördert werden, entscheidet letztlich auch mit darüber, welche Gesellschaftsmodelle und Technologien entstehen. Ihr Forschungsprojekt soll deshalb auch ergründen, wie inklusiv oder exklusiv das Start-up-Ökosystem wirklich ist – und welche sozialen Konsequenzen die Konzentration von Kapital dort mit sich bringt. Noch steckt die Forschung zu diesem Thema am Anfang, aber genau diese Fragen treiben sie an.
Familie und Eigentum neu denken
Für Stamm ist klar: Wer die sozialen Strukturen von Reichtum verstehen will, muss sich mit Familien beschäftigen. "Die Bedeutung der Familie für die Art und Weise, wie Wirtschaft in Deutschland organisiert ist, wird bisher unterschätzt." Denn hinter dem Erhalt und der Vermehrung von Vermögen steckt oft ein unsichtbares Netzwerk aus familiären Beziehungen – Partnerschaften, Ehen, generationsübergreifende Bindungen.

Isabell Stamm mit ihrem Kollegen Allan Sandham.
Diese zentrale Rolle der Familie wird in öffentlichen Debatten wie auch in der Forschung häufig übersehen, obwohl selbst einflussreiche Lobbyorganisationen sogar "Familie" in ihren Namen tragen – sei es die Stiftung Familienunternehmen oder der Verband der Familienunternehmer. Nachdenklich fragt Stamm: "Aber ist es richtig, dass es diese enge Verbindung zwischen Unternehmen und Familie gibt und immer mehr Eigentum an Unternehmen in den Händen von immer weniger Familien liegt?"
Was wäre, wenn Eigentum an Unternehmen zeitlich befristet wäre?
Statt vorschneller politischer Forderungen plädiert Stamm dafür, Eigentum grundlegend neu zu denken. "Was wäre, wenn Eigentum an Unternehmen zeitlich befristet wäre? Oder wenn Eigentum stärker mit sozialen Pflichten einherginge, wie es das Grundgesetz bereits vorsieht?", wirft sie fragend auf. Ein mögliches Modell sieht sie im sogenannten Verantwortungseigentum: Unternehmen, bei denen Gewinne nicht für den privaten Profit entnommen werden dürfen, sondern zweckgebunden im Unternehmen verbleiben. Für Stamm ist das keine politische Forderung, sondern ein kreativer Impuls, um über Gerechtigkeit, Verantwortung und die Zukunft wirtschaftlicher Macht neu nachzudenken.