Was fasziniert junge Leute an Rechtsaußen?
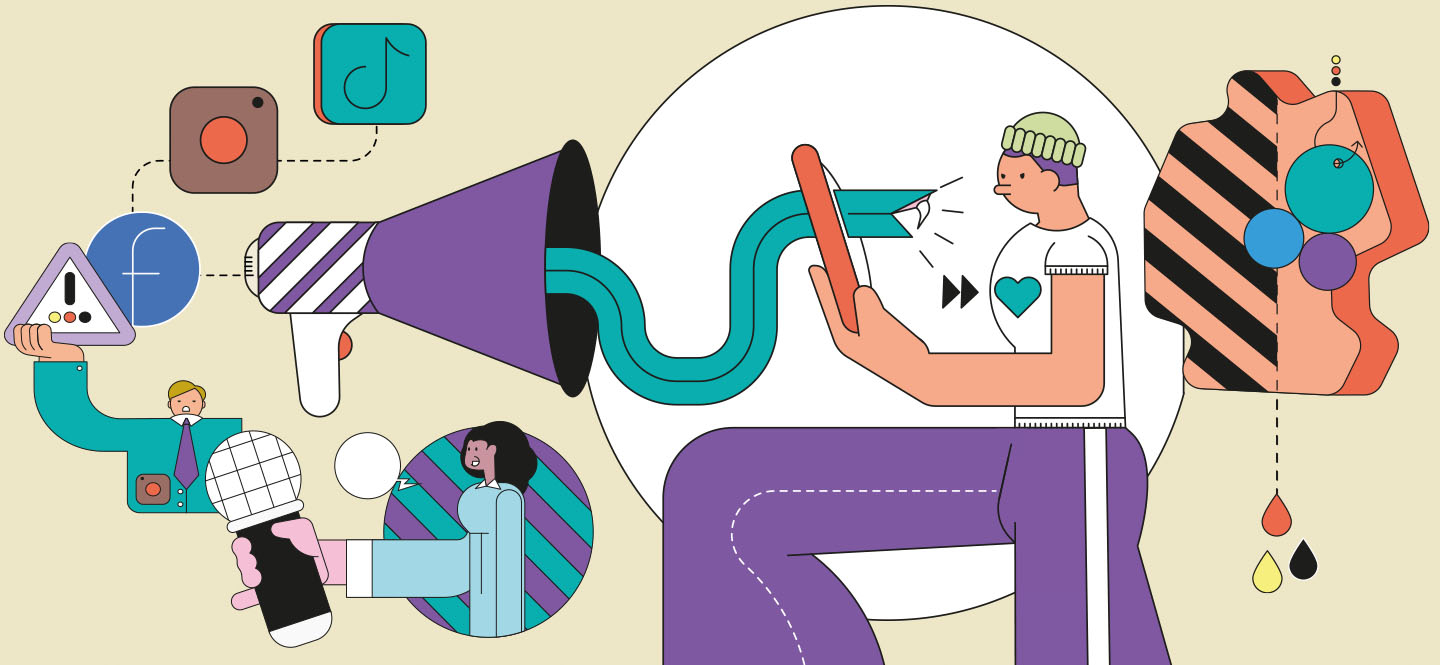
Tobias Wandres/VolkswagenStiftung
Demokratiefeindlichkeit in Deutschland nimmt zu. Dennoch kümmern sich Politik und Wissenschaft wenig um die Einstellungen einer besonders wichtigen Gruppe: die jungen Wähler und Wählerinnen. Ein interdisziplinäres Projekt in östlichen Bundesländern nimmt das nicht hin.
Zwischen Trier und Dresden liegt manchmal nur die Länge eines Daumens. Eva Walther streckt ihn in die Höhe. "Cathleen, die Zahlen aus der zweiten Welle sind heute eingetroffen", sagt die Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Trier in die Kamera ihres Rechners. "Toll, da bin ich gespannt", sagt Cathleen Bochmann im Call. "Mal sehen, ob sich einige Ahnungen von uns bewahrheiten."
Die promovierte Politologin Bochmann arbeitet bei Aktion Zivilcourage, der Verein setzt sich für die Stärkung demokratischer Kultur in Sachsen ein. Und sie hat da etwas gespürt, schon vor Monaten – dem will die Praktikerin gemeinsam mit wissenschaftlicher Expertise auf den Grund gehen: "Woher kommt diese Wut, die wir mitkriegen?", fragt sie.

"Du wirst in den Zahlen vielleicht lesen, was wir nicht erkennen", schaltet sich eine dritte Frau in die Konferenz ein. Anna-Sophie Heinze, auch promovierte Politologin, arbeitet – wie Walther – an der Uni Trier. Die drei haben sich zusammengeschlossen, um einem unterbelichteten Thema auf die Spur zu kommen: Woher kommt und wie wirkt der wachsende Einfluss von Rechtsaußenparteien auf junge Wähler:innen und Erstwähler:innen in Ostdeutschland? Seit April 2024 erkundet dieses Trio aus Wissenschaft und Praxisarbeit in einem transdisziplinären Ansatz die Einstellungen zu Demokratie und wie man diese positiv stärken kann – ein Jahr lang gefördert von der VolkswagenStiftung im Rahmen der Initiative "Transformationswissen über Demokratien im Wandel – transdisziplinäre Perspektiven". Der Titel des Projekts: "Nurturing Democratic Resilience among Youth to Counter Far-Right Influence in the Eastern German Elections 2024 (NurtureDEMOS)."
"Das Thema hat danach geschrien, dass wir miteinander kooperieren", sagt Heinze. Denn damit füllen sie gleich mehrere Lücken.
Licht auf den schwarzen Fleck
Da ist zum einen die jahrelange Erfahrung der Mitarbeitenden bei Aktion Zivilcourage, die teilweise seit den Neunzigern Basisarbeit leisten und nun merken: Eine Entwicklung macht sich breit, in der Rassistisches und Demokratiefeindliches mit neuem Selbstbewusstsein vorgetragen wird, "da wird eine andere kulturelle Hegemonie aufgebaut", sagt Bochmann. "Und es ist eigentlich verrückt, dass zu Jugend und Politik so wenig geforscht wird", sagt Heinze. Walther ergänzt: "Ähnlich wenig ausgeleuchtet sind die psychologischen Faktoren für junge Leute bei ihrem Wahlverhalten. Um dieses zu ergründen, braucht es aber beides: Die Sozialpsychologie und die Politikwissenschaft"; beides im steten Sparring mit Aktion Zivilcourage aus der Zivilgesellschaft.
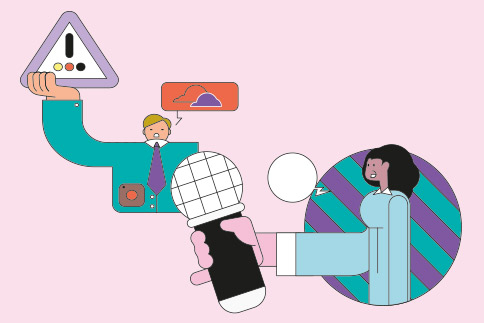
Also bringen die drei seit vergangenem Frühling ihre jeweiligen Expertisen ins Projekt ein. Heinze untersucht die Angebote der Parteien für junge Menschen, ihre Programme und Organisationen – dafür führte sie eine Reihe von Interviews mit jungen Funktionären. Walther dagegen erforscht die Nachfrageseite, und zwar mit zwei aussagefähigen Umfragen, in denen sich rund 1850 Personen vor und nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen äußerten. "Jetzt werden wir uns an die Auswertung der zweiten Welle nach den Wahlen setzen", kündigt Walther an. Darüber hinaus organisieren die drei "Round-Table-Formate", bei denen verschiedene Akteur:innen aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenkommen und miteinander diskutieren. Der geplante Output: Mehrere wissenschaftliche Artikel in beiden Fachdisziplinen, aber auch griffige Policy Papers für Interessierte zum schnellen Briefing.
Erste Projektergebnisse gibt es in der Studie "Demokratie in Gefahr? Wahlstudie in Ost-Bundesländern zeigt Misstrauen in Staat" (Link zur Studie zum Download: https://www.komrex.uni-jena.de/komrexmedia/5280/policy-paper.pdf)
Und Aktion Zivilcourage baut diese Infos in ihre Workshops ein, in denen sich Jugendliche im vergangenen Sommer intensiv mit Parteiprogrammen auseinandersetzten. Ziel wird eine Art Toolkit sein, mit dem Jugendliche vor Ort ihre Selbstwirksamkeit ertasten, politische Partizipation ausprobieren, sich so einerseits fit machen im Erkennen von Populismus und andererseits eine positive Beziehung zur Demokratie pflegen. Daher der Fokus des Projekts auf die lokale Ebene und auf die Zivilgesellschaft. Bochmann: "Damit Jugendliche, die sich engagieren wollen, sich nicht ohne Möglichkeiten sehen."
Einige Korrekturen sind angesagt
Und was sind die Erkenntnisse, was hilft gegen "Rechts"? Heinze lacht. "Das ist natürlich die ‚eine-Million-Euro-Frage‘", bescheidet sie. Und Walther: "Noch sitzen wir dran." Aber es gibt erste Ergebnisse: "Es fällt auf, dass politische Strukturen wie die von Parteien oder von Institutionen wenig auf die Bedarfe von jungen Leuten ausgerichtet sind", so Bochmann, die das starke Abschneiden der AfD bei den Wahlen lange vorher erwartet hatte. Hinzu komme, dass bei für Junge wichtigen Informationsquellen wie TikTok und Instagram von den Parteien die AfD mit Abstand am besten aufgestellt sei, so Walther. "Mit ihrer Komplexitätsreduktion hat die Partei in den sozialen Medien zusätzlich einen Standortvorteil. Denn Probleme werden dort erregt und skandalisierend thematisiert."
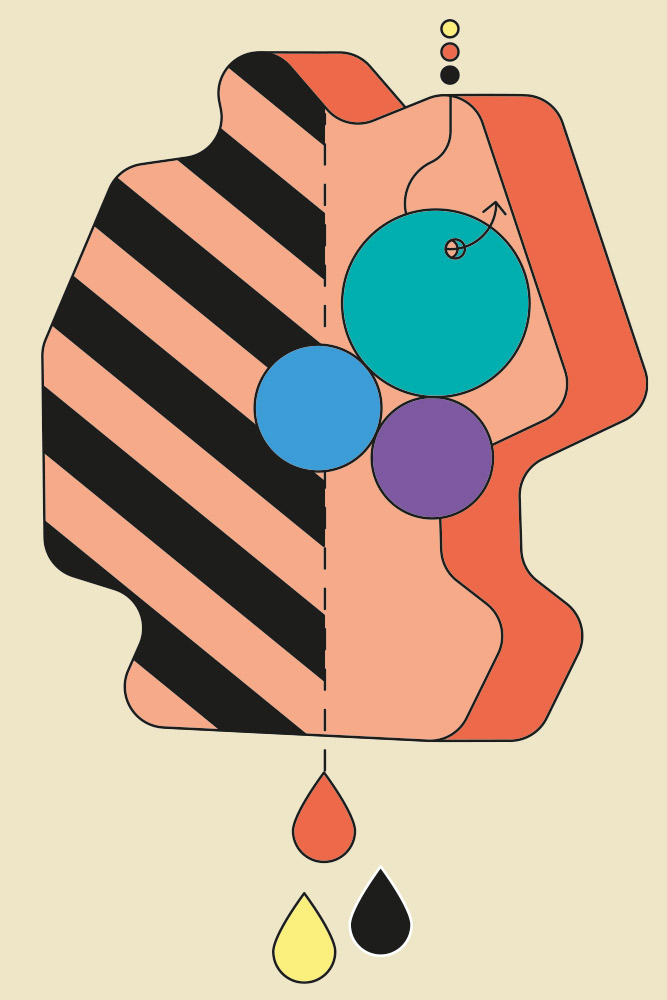
Mit einigen Vorurteilen räumen die vorläufigen Erkenntnisse des Projekts auch auf. "Die Jugend ist weder rechts noch TikTok", sagt Heinze. "Sie ist politisierter als vorherige Generationen und zeigt ein recht volatiles, fragmentiertes Wahlverhalten, bei dem auch kleine Parteien gut wegkommen." Und junge Leute seien durchaus pragmatisch, ihnen seien Themen wie Inflation, Wirtschaft und Rente, Klima und Krieg durchaus wichtig, ergänzt Bochmann. "Sie sind keine anderen Wesen." Aus der ersten Umfrage, setzt Walther fort, hätten sie erfahren, dass eine Stimme für die AfD tendenziell weniger eine sogenannte Denkzettel- oder Protestwahl sei. "Dieses Gerücht findet sich in unseren Zahlen überhaupt nicht." Denn die Sympathien und das Wahlverhalten würden bei der AfD im Vergleich zu anderen Parteien am höchsten miteinander korrelieren. Heißt: "Die AfD-Wähler:innen sind sehr unzufrieden mit der Politik und dem politischen System. Aber mit der AfD sind sie sehr zufrieden." Damit umschreibt sie die Herausbildung einer Volkspartei.
Die drei nehmen einen Widerspruch wahr: Zwar werden sie oft von Medien zu den Erfolgen der AfD befragt, zum politischen Verhalten Jugendlicher. Aber dennoch sei bei der Wahrnehmung der Wichtigkeit dieses Thema noch Luft nach oben, sagt Heinze, "und zwar bei der Wissenschaft, in der Politik und in der Zivilgesellschaft gleichermaßen".
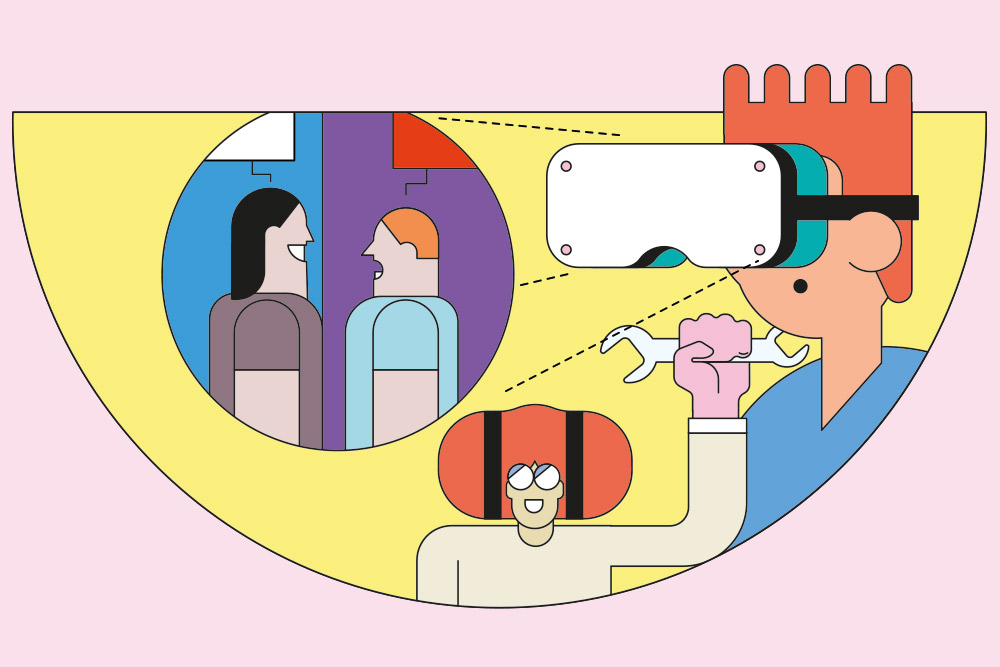
Neue Wege braucht das Land
Und so proben die drei noch bis in den Frühling 2025 neben der Ausarbeitung ihrer Erkenntnisse an neuen Wegen zur Förderung demokratischer Resilienz. "Die Angebote müssen lokal und passgenau sein", sagt Bochmann. "Sie sollten auf die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten sein"; derzeit experimentieren sie bei Aktion Zivilcourage etwa mit VR-Brillen als Instrumente politischer Bildung – eben alles, um junge Leute zu erreichen und abzuholen. "Jede von uns dreien bringt ihre Puzzlestücke mit ein", sagt sie. Am Ende wird ein Mosaikbild entstehen, das helfen kann. "Junge Leute sind nicht nur die Wähler:innen von morgen", schließt Heinze. "Sie sind mitentscheidend bei der Antwort auf eine wichtige Frage: Wird Rechtsaußen in Deutschland nun normal?"


